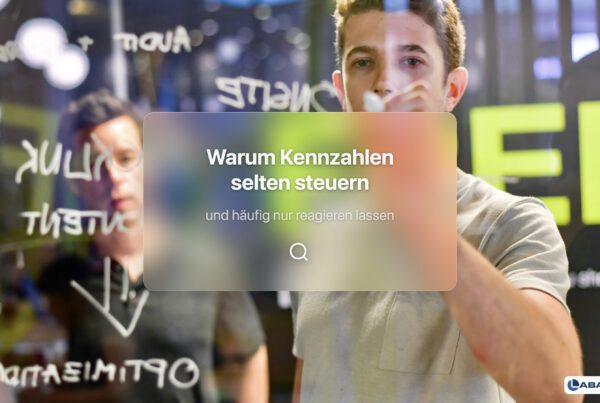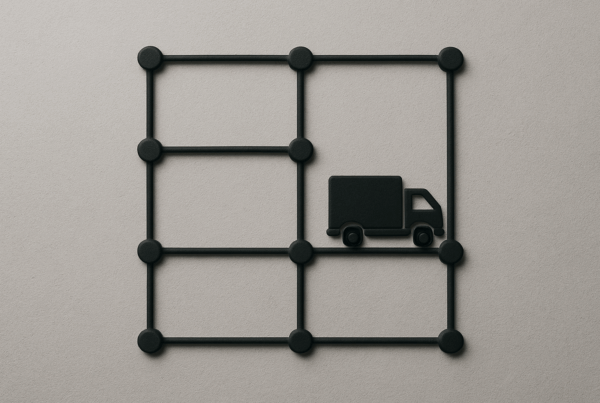Die Zukunft des elektronischen Datenaustauschs in der Logistik
Am Mittwoch ging die Rechnung nicht auf. Mit 318 zu 309 Stimmen lehnte das EU-Parlament das Verhandlungsmandat zur Vereinfachung der Nachhaltigkeitsregeln ab. Statt schneller Verhandlungen gibt es jetzt: Verzögerung bis mindestens 13. November, neue Änderungsanträge, unklare Mehrheiten. Für Unternehmen in der Logistik und im Supply Chain Management bedeutet das vor allem eines: Weiter im Ungewissen tappen.
Der ursprüngliche Vorschlag klang verlockend: Drastische Vereinfachung der Berichtspflichten. Nur noch Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern und 450 Millionen Euro Jahresumsatz sollten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sein. Sorgfaltspflichten in der Lieferkette? Erst ab 5.000 Beschäftigten und 1,5 Milliarden Euro Umsatz.
Doch die Realität ist komplexer. In einer repräsentativen Umfrage unter europäischen Führungskräften sprachen sich 50 Prozent dafür aus, den Schwellenwert auf 250 oder 500 Mitarbeitende abzusenken. Warum? 53 Prozent erwarten eine Stärkung der europäischen Zulieferindustrie durch ambitionierte Sorgfaltspflichten. 48 Prozent sehen darin einen langfristigen Wettbewerbsvorteil.
Die Message: Viele Unternehmen wollen keine Deregulierung. Sie wollen klare, praktikable Standards, die ihnen im globalen Wettbewerb helfen.
Der risikobasierte Ansatz: Klingt gut, aber wie funktioniert er?
Ein Kernstück der Reform ist der risikobasierte Ansatz: Statt systematisch alle Geschäftspartner zu durchleuchten, sollen Unternehmen nur dort nachfragen, wo tatsächlich Menschenrechts- oder Umweltrisiken drohen. Das klingt nach gesundem Menschenverstand.
Aber wer definiert, was ein Risiko ist? Die Antwort liegt in den Daten. Und hier wird es für Logistikunternehmen ernst:
- Lieferkettenvisibilität: Wer nicht weiß, wo seine Tier-2- oder Tier-3-Zulieferer produzieren, kann Risiken nicht einschätzen.
- Echtzeit-Monitoring: Einmal im Jahr einen Report zusammenstellen? Nicht mehr zeitgemäß. Kontinuierliche Überwachung wird zum Standard.
- Nachweisbarkeit: Bei Strafen von bis zu 5 Prozent des Weltumsatzes will niemand auf Lücken in der Dokumentation erwischt werden.
Und welche Rolle spielt EDI?
Jahrzehntelang war Electronic Data Interchange das Rückgrat für Bestellungen, Rechnungen und Lieferavis. Jetzt wird es zum entscheidenden Faktor für Nachhaltigkeits-Compliance.
Warum? Weil moderne Supply Chain Due Diligence ohne strukturierte Datenströme nicht funktioniert.
- Emissionsdaten müssen automatisch erfasst und aggregiert werden – pro Lieferung, pro Route, pro Partner.
- Zertifikate und Audits von Zulieferern müssen digital abrufbar und verifizierbar sein.
- Anomalie-Erkennung braucht kontinuierliche Datenflüsse, um problematische Muster frühzeitig zu identifizieren.
- Reporting wird nur dann handhabbar, wenn die Daten bereits strukturiert vorliegen – nicht wenn sie mühsam aus E-Mails und Excel-Sheets zusammengesucht werden müssen.
Was Logistikunternehmen jetzt tun sollten
Die politische Unsicherheit ist ärgerlich, aber sie ändert nichts an der Grundaufgabe. Egal ob die finale Regelung bei 500 oder 5.000 Mitarbeitern ansetzt – die Anforderung bleibt: Supply Chains müssen transparent und dokumentierbar sein.
Drei konkrete Schritte:
- Datenqualität systematisch verbessern Fehlerhafte oder unvollständige Stammdaten bei Lieferanten sind der Killer für jedes Nachhaltigkeitsreporting. Wer heute aufräumt, spart morgen Panik und Kosten. Das bedeutet: Lieferantendaten standardisieren, Dubletten bereinigen, fehlende Informationen systematisch nachfordern.
- EDI-Integration erweitern EDI kann mehr als Bestellungen und Lieferavise. Moderne EDI-Systeme können Nachhaltigkeitsdaten wie CO₂-Werte, Zertifikate oder Auditberichte nahtlos integrieren. Die Infrastruktur dafür sollte jetzt aufgebaut werden. Nicht erst, wenn die Deadline droht.
- Monitoring-Systeme implementieren Reaktives Reporting reicht nicht mehr. Unternehmen brauchen Dashboards und Alerting-Systeme, die Risiken in Echtzeit sichtbar machen: Welcher Zulieferer hat sein ISO-Zertifikat nicht verlängert? Wo gibt es Auffälligkeiten bei Emissionsdaten? Welche Partner haben ihre vertraglichen Nachhaltigkeitszusagen nicht erfüllt?
Während Brüssel über Vereinfachung diskutiert, wird die technische Komplexität größer. Nicht weil die Anzahl der Anforderungen steigen, sondern weil die Erwartung an Präzision und Nachweisbarkeit steigt. „Ungefähr nachhaltig“ reicht nicht mehr, weder für Auditoren noch für Kunden.
Für Supply Chain- und Logistikunternehmen bedeutet das: Die Zeit der Excel-Listen ist vorbei. Wer im November oder Dezember eine finale Regelung abwarten will, verliert wertvolle Monate. Die Systeme, die jetzt aufgebaut werden müssen, wie Datenintegration, Monitoring und Reporting, brauchen Zeit zur Implementierung und Optimierung.
Der Wettbewerbsvorteil liegt in den Daten
Die gute Nachricht: Unternehmen, die ihre Dateninfrastruktur in Ordnung bringen, gewinnen mehr als nur Compliance. Sie gewinnen Transparenz über ihre eigenen Prozesse. Sie können schneller auf Störungen reagieren. Sie können ihren Kunden belastbare Nachhaltigkeitsnachweise liefern. Ein Argument, das in immer mehr Ausschreibungen den Unterschied macht.
Viele der europäischen Führungskräfte erwarten eine Stärkung der Zulieferindustrie durch ambitionierte Sorgfaltspflichten. Das ist kein Zufall. Wer heute die Hausaufgaben macht, hat morgen einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz.
Die Frage ist nicht ob, sondern wann die Regeln kommen. Und wer dann nicht vorbereitet ist, hat ein Problem, das kein politischer Kompromiss lösen kann.